Zurück zur
Startseite
Optologie
Versuche zur
Farbenstereopsis
und eine
daraus entwickelte Theorie
Hans W. Riedl,
Staatl. gepr. Augenoptiker, WVAO
Hersbruck, Dezember
2003
|
Schlüsselwörter / keywords |
|
|
Achse |
axis |
|
Aperturblende |
aperture stop |
|
Auge, abweichendes |
deviating eye |
|
Auge, führendes |
leading eye |
|
Auge, schematisches |
schematic eye |
|
Empfindung |
sensation |
|
Farbenfehler |
chromatic aberrations, CA |
|
Farbenlängsfehler |
longitudinal CA |
|
Farbenquerfehler |
transverse CA |
|
Farbenstereopsis |
chromostereopsis |
|
Fixationsdisparation, FD |
fixationdisparity |
|
Fixierlinie |
visual axis |
|
Foveolamitte |
foveola centre |
|
Gesichtslinie |
line of vision |
|
Hauptstrahl |
chief ray |
|
Mikrobewegung |
micromovement |
|
Netzhautgrube |
fovea |
|
Reizverarbeitung |
stimulus processing |
|
Sehachse |
line of vision |
|
Sehen, mesopisches |
mesopic vision |
|
Sehen, photopisches |
photopic vision |
|
Stiles-Crawford-Effekt |
directional effect |
|
Strahlenkegel |
cone of rays |
|
Tiefenwahrnehmung |
depth perception |
|
Visierlinie, reale |
verifiable line of sight |
|
Winkel Gamma |
angle gamma |
|
Winkel Kappa |
angle kappa |
|
Winkelfehlsichtigkeit |
associated heterophoria |
|
Zapfen (Farbrezeptor) |
Cone |
Zusammenfassung
Das
Phänomen Farbenstereopsis wird unter dem Gesichtspunkt
Stiles-Crawford-Effekt
(SCE) untersucht. Versuche des Autors lassen auf zwei verschiedene
Ursachen von
binokular räumlicher Wahrnehmung verschiedenfarbiger benachbarter
ebener
Objekte schließen: Im photopischen Sehen:
Farbzerlegung
polychromen Lichtes durch das optische System bei Fixationsdisparation
Im
mesopischen Sehen:
Horizontal versetzte Empfindungsmaxima
unterschiedlicher Zapfentypen verursachen querdisparate Bildlagen
für die
jeweils von ihnen absorbierten Farben Mit dem Nachweis der
Wirksamkeit der Empfindungsmaxima als Zentren virtueller (sensorischer)
Aperturblenden erfährt der Stiles-Crawford-Effekt im Ganzen eine
unübersehbare
optometrische Gewichtung.
Rückblick
Seit Prof.
Donders an einer gemusterten
Tapete die aufregende Beobachtung machte, das Netz gelber Streifen
plötzlich
deutlich vor dem blau-schwarzen Hintergrund stehen zu sehen (Abb.1),
sein
Assistent Einthoven im Jahr 1885 das Phänomen untersuchte
und sein
Ergebnis veröffentlichte, erklärt man den Begriff
Farbenstereopsis, ungenau mit
Farbenstereoskopie bezeichnet, als ein unter bestimmten Voraussetzungen
im
Binokularsehen zustande kommendes Resultat der chromatischen Aberration
(Farbenfehler) des Auges

Abbildung 1:
An einer Tapete mit einem Netz gelber
Streifen auf
blau-schwarzem Grund hatte Donders das aufregende Erlebnis
der
Farbenstereopsis
Einthoven führte die Wahrnehmung
auf den Farbenfehler des Auges und auf die Annahme zurück, die
„optische Achse“
des Auges durchstoße die Netzhaut nicht am Ort der Netzhautgrube,
sondern in
einem mehr oder weniger großen Abstand daneben. Für Einthoven
war die
vermeintliche Dezentration maßgebliche Voraussetzung für die
Wahrnehmung von
Farbenstereopsis!
Gammawinkel
Der Begriff
„Farbenstereoskopie“ taucht seitdem
immer wieder in der Fachliteratur auf, wenn es darum geht, auf
Auswirkungen des
Farbenfehlers der Augen hinzuweisen. Auch der Autor des vorliegenden
Artikels
versuchte sich vor längerer Zeit schon einmal an diesem Thema [1].
Auf der
Suche nach einer Bestätigung für den dem Gammawinkel zugrunde
gelegten
angeblichen Versatz der Foveolamitte gegenüber dem hinteren
Augenpol, wurde er
auf einen Fachartikel von Dr. Reiner [2] verwiesen, der die
Untersuchungen von Einthoven aufgreift und in Beziehung zum
Rot/Grün
-Test setzt. Reiner bringt – ebenso wie vor ihm auch Tscherning
[3] – die versetzte Netzhautgrube des Auges mit dem Winkel Gamma in
Verbindung.
Gängige Auslegung
Nichtsdestoweniger
dient das Argument
„Farbenstereopsis“ immer wieder als Hinweis auf eine vermutete
Versetzung der
Foveolamitte gegenüber dem hinteren Augenpol [4]. Der Winkel
zwischen
Fixierlinie und optischer Achse wird Winkel Gamma genannt. Laut
Wörterbuch der
Optometrie, also noch aktuelle Fachliteratur, wird der Winkel positiv
gerechnet, wenn der hintere Augenpol gegenüber der Foveolamitte
nasal versetzt
ist, und sinngemäß negativ, wenn der Pol gegenüber der
Foveolamitte temporal
versetzt ist (Frage: Wird der Winkel bildseitig vom Knotenpunkt K' aus
gemessen
und gibt den Abstand zwischen hinterem Augenpol und Foveola an, oder
wird er
objektseitig zwischen Fixierlinie und optischer Achse ausgehend von der
Mitte
der Eintrittspupille gemessen, wie es DIN 5340 definiert?). Die
angeblich
möglichen Versetzungen des hinteren Augenpols gegenüber der
Foveola reichen von
2,5 mm nasal bis 1 mm temporal, in angularem Maß für
den Winkel Gamma soll
dies Werten von +8 Grad bis –3 Grad entsprechen [5].
Achtung! Abweichend von DIN 5340 definiert
der Autor reale Visierlinie und Gesichtslinie als Geraden durch die
Mitte der
Foveola (siehe Abb. 8). Der Gammawinkel ist im photopischen Sehen das
Maß
zwischen physiologischer Augenachse und realer Visierlinie, der Winkel
Kappa im
mesopischen Sehen das Maß zwischen physiologischer Augenachse und
Sehachse
(Gesichtslinie).
Reiner vermittelt in seinem
Artikel - vermutlich unabsichtlich - den Anschein, dass positiver und
negativer
Winkel Gamma etwa gleich häufig auftreten. Einthovens
dreißig
Versuchspersonen hatten nämlich je zur Hälfte
farbenstereoskopische
Wahrnehmungen, die bei seiner Argumentation entweder dem positiven (Rot
vor
Grün) oder dem negativen Gammawinkel (Grün vor Rot)
zugeordnet werden müssten.
Allein schon eine derartige Häufigkeitsverteilung positiver und
negativer
Gammawinkel lässt doch gewisse Zweifel aufkommen!

Abbildung
2: Beispiel einer zur Wahrnehmung von Farbenstereopsis geeigneten
rot/grünen
Testfigur auf weißem Grund

Abbildung
3: Die gleiche Testfigur Rot/Grün auf schwarzem Untergrund

Abbildung
4: Versuche am Monitor eines PC. Bei für Tagessehen
Umkehrung der
Stereopsis
Ganz und gar
verworren wird die Lage, wenn – wie es
Schober beschreibt und auch anhand der Abbildungen 2 und 3 oder
bei
Experimenten am PC (Abb. 4) vom einen oder anderen Leser (es kann
naturgemäß
nicht bei allen klappen!) im Eigenversuch bestätigt werden wird –
beim Wechsel
der Hintergrundfarbe von Schwarz bzw. monochrom auf Weiß die
räumliche
Wahrnehmung auch noch ins Gegenteil umschlägt. Diese Situation
lässt sich nun
keinesfalls mehr in eine verständliche Beziehung zum Gammawinkel
bringen!
Der Autor beendete
seinen damaligen Aufsatz damit,
seine Arbeit als noch nicht abgeschlossen zu betrachten, Schobers
Erklärung (siehe Kasten) könne seiner Meinung nach aber
möglicherweise den
Schlüssel zur Auflösung der Frage beinhalten, da diese
Erklärung ausdrücklich
auf die Bedeutung der Hintergrundfarbe eingehe:
Prof. Schober führt die
Umkehrung der räumlichen Wahrnehmung darauf zurück, dass das
Wesen der
Farbenstereoskopie eine relative Wahrnehmung sei [6], die als Wettstreit
zwischen der Wirkung des Objektes und seines Hintergrundes aufgefasst
werden
könne.
(nach
Schober)
So sehr den Autor
zunächst noch
Zweifel an Schobers sibyllinischer Deutung verunsicherten, so
sicher
glaubt er heute sein zu können, dass sich dahinter die Lösung
verbergen müsse:
Weißer Hintergrund
enthält alle
Farben
► Empfindung
chromatischer Aberration
(Farbenquerfehler) ist möglich
Schwarzer oder
monochromer
Hintergrund
► Empfindung
chromatischer Aberration ist nicht
möglich; der „Wettstreit entfällt“ ...
Strahlenbegrenzung
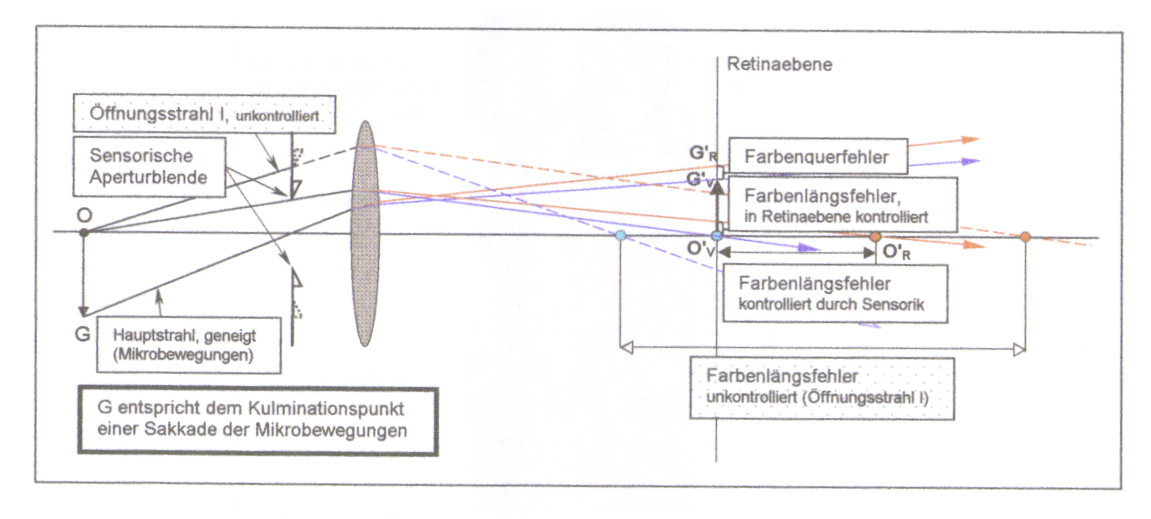
Abbildung
5: Der Effekt der sensorischen Aperturblende (Begrenzung des
Strahlenbündels)
beruht auf Kontrolle des Farbenlängsfehlers O'R O'V
in
der Foveola nach Maßgabe des bei den Mikrobewegungen
registrierten
Farbenquerfehlers G'R G'V; die Darstellung
einer
„körperlichen Aperturblende“ ist symbolisch für die
Auswirkung der
Fehlerkontrolle zu verstehen.
Man
fragt sich natürlich, wozu das Ganze? Die Antwort liegt wohl in
der
geheimnisvollen Eigenart der Strahlenbegrenzung des visuellen Systems
begründet! Um das Gehirn nicht mit unbrauchbaren Informationen
durch jede Art
von Abbildungsfehlern zu überfluten, muss der Strahlenkegel, der
zur Information
über zentrale Abbildung genutzt wird, begrenzt werden. Da an einer
wirksamen
Einschränkung des Strahlenbündels keine körperliche
Aperturblende beteiligt
sein kann [7], kommt nur eine sensorische Selektion der
Öffnungsstrahlen
infrage. Dass im Sehprozess so eine Art Selektion stattfinden muss,
lässt sich
ohne Zweifel am Stiles-Crawford-Effekt (SCE) mit der verminderten
Effizienz
peripher in die Eintrittspupille einfallender Fixierstrahlenbündel
nachweisen!
Legt
man nun der Überlegung die Untersuchungen von Stiles [8]
zugrunde, so
bekommt Schobers „Wettstreit“ in Bezug auf Farbenstereopsis und
Hintergrundfarbe – in einer völlig neuen, jedoch mit dem SCE
nachvollziehbaren
Betrachtungsweise – ein ganz anderes Gewicht. Der Wettstreit beschreibt
die
Schwelle, die das retinale Umschalten von einer in eine andere
Selektionsform
veranlasst. Offenbar liegt sie in der fovealen Fähigkeit,
Farbenfehler
empfinden und auswerten zu können.
Im
Tagessehen befähigt weißer Hintergrund die Fovea, Dispersion
zu empfinden und
zu bewerten. Der einzig denkbare sensorisch nutzbare Abbildungsfehler
ist der
Farbenfehler: Der durch Neigung des Hauptstrahls bei den
Mikrobewegungen
entstehende oszillierende Farbenquerfehler stellt das Maß des
Unabwendbaren
dar. Hat die Foveola also die Möglichkeit, durch sensorische
Kontrolle des
Farbenlängsfehlers den Strahlenkegel auf dieses unvermeidliche
Maß an zu
empfindender Dispersion zu begrenzen (Abb.5), so reduziert sie damit
effektiv
alle anderen Abbildungsfehler. Der bei den Mikrobewegungen registrierte
Farbenquerfehler scheint die maßgebliche Größe zu
sein, den die Sensorik der
Foveola – weil unabwendbar – zu tolerieren bereit ist. Die Empfindung
des
Farbenfehlers hat also für die Qualität des photopischen
Sehens geradezu
elementare Bedeutung!
Anders bei
schwarzem oder monochromem Hintergrund:
Bei den Mikrobewegungen ist der Farbenquerfehler nicht zu registrieren.
Die
Foveola hätte keine Chance, Abbildungsfehler auf ein für das
Gehirn erträgliches
Maß zu reduzieren. Die Retina muss auf eine andere Art der
Reizverarbeitung
umstellen, die über eine eigene Strahlenbegrenzung verfügt:
die
Hohlleiterfunktion der Photorezeptoren. Mechanismen der Hohlleiter
bewirken
eine Strahlenbegrenzung, die dem Effekt einer sensorischen
Aperturblende zwar
ähnelt, jedoch mit dem Unterschied, dass jeder Rezeptortyp
über ein eigenes
Strahlenbündel nur des Spektralbereichs, für den er bevorzugt
sensibilisiert
ist, verfügt. Die Vermutung liegt nahe, dass diese retinale
Funktion im
Dämmerungssehen (mesopisch) aktiv ist.
Stiles’ und Crawfords
Untersuchungen
Sieht man sich die
Untersuchungen von Stiles
und Crawford im weißen Licht und die von Stiles
im monochromen
Licht – in Schritten verteilt über den Bereich von 440nm bis 720nm
– bei der
Versuchsperson W.S.S. genauer an (Abb.6), so ergibt sich neben dem
Empfindungsmaximum für weißes Licht eine eindeutige
Zuordnung von Wellenlängen
zu Absorptionsbereichen der Farbrezeptoren. Jeder Photorezeptortyp (S,
M, L)
verfügt über ein eigenes Empfindungsmaximum. Entsprechend der
Ausrichtung
(Orientierung) der Rezeptoren haben diese Empfindungsmaxima
verschiedene
Positionen an der ersten brechenden Fläche des Auges.

Abbildung 6:
SC-Empfindungsmaxima
auf der horizontalen Traverse durch die Mitte der Eintrittspupille der
Versuchsperson
W.S.S. (L) nach Angaben von W.S.Stiles und B.H.Crawford (1932) zu
Effizienzmessungen im weißen Licht, bzw. W.S.Stiles zu
Effizienzmessungen in monochromem
Licht (1937), und Zuordnung zu bevorzugten Absorptionsbereichen der
Photorezeptoren.
*S = short wavelength;*M
= middle wavelength; *L = long wavelength;**
(-) = nasal; (+) = temporal.
Die Versuchsperson Stiles
dient mangels
weiterer Messergebnisse an anderen Probanden –
über entsprechende Frequenzbereiche – als
vorläufigeinziges Anschauungsobjekt. Da außer dieser Tabelle
keine weiteren
Messungen über vergleichbar ausgedehnte Spektralbereiche
vorliegen, muss auch
über ungeklärte Differenzen in der zweiten Stelle hinter dem
Komma
hinweggesehen werden.
Zur Verdeutlichung hat
der Autor
die Empfindungsmaxima Stiles’ (Stiles verwendet ein
Messbündel mit
Durchmesser 1,0 Millimeter in Ebene der Eintrittspupille) in die
Eintrittspupille des untersuchten Auges (W.S.S.) von 8 Millimeter
Durchmesser
eingezeichnet (Abb.7). Es wird unterstellt, dass die Positionen in
beiden Augen
symmetrisch vorzufinden sind.

Abbildung 7: Position des
Empfindungsmaximums für weißes Licht (-0,2mm) und die
Orientierung foveolärer
Photorezeptoren (S +0,49; M +0,32; LI+0,57; LII+0,67)
in
der Eintrittspupille des linken Auges der Versuchsperson W.S.S.; Stiles
verwendete für seine Effizienzmessungen einen
Bündeldurchmesser von 1,0
Millimeter in Ebene der Eintrittspupille.
Bezugsblickrichtung
und Richtungswert
1.
Im
photopischen Sehen bei weißem Hintergrund ist
für die Abbildung im Auge die sensorische Aperturblende für
weißes Licht, die
sich an der Position des Empfindungsmaximums für weißes
Licht orientiert,
maßgebend. Bei zentraler Fixation hat die Mitte der Foveoladen
Richtungswert
Geradeaus. Die Bezugsblickrichtung ist durch das Empfindungsmaximum –
identisch
mit dem ophthalmometrischen Pol – festgelegt (Abb.7).
2.
Im
mesopischen Sehen ist die Hohlleiterfunktion
aktiviert. An der Ausrichtung der Photorezeptoren orientiert sich die
Position
des jeweiligen Empfindungsmaximums. Da wegen unterschiedlich
positionierter
Empfindungsmaxima jeweils nur ein Typ zentraler Photorezeptoren (L oder
M) den
Richtungswert Geradeaus haben kann, übernimmt dieser im
mesopischen Sehen die
Führung (Sehachse).Sein Empfindungsmaximum legt die
Bezugsblickrichtung
(Nullrichtung) fest.
Während
im monokularen photopischen Sehen die Mitte der Foveola den
Richtungswert
Geradeaus hat, trifft diese Aussage im mesopischen Sehen nur für
den
Rezeptortyp der Foveola zu, der die Führung bei der Fixation
wahrnimmt.
Der
Überlegung des Autors zu Abbildung 8 wurde zugrunde gelegt, dass
der M-Rezeptor
die Führung innehabe (Grün wird fixiert). Der zentrale
Hauptstrahl geht durch
die Mitte der Aperturblende (Empfindungsmaximum) des führenden
Rezeptors. Für
Bildkonstruktionen sind auf diesem Hauptstrahl die Knotenpunkte KM
und
K'M (vereinfacht KM) anzusetzen. Rezeptortypen
mit davon
abweichender Orientierung haben von der Nullrichtung verschiedene
Richtungswerte. Ihre Empfindungsmaxima/Aperturblenden erzeugen
Abbildungen, die
auf den Retinae versetzt (disparat) liegen. Objekte mit binokular
querdisparaten Bildorten innerhalb der Panumareale werden
räumlich
wahrgenommen.
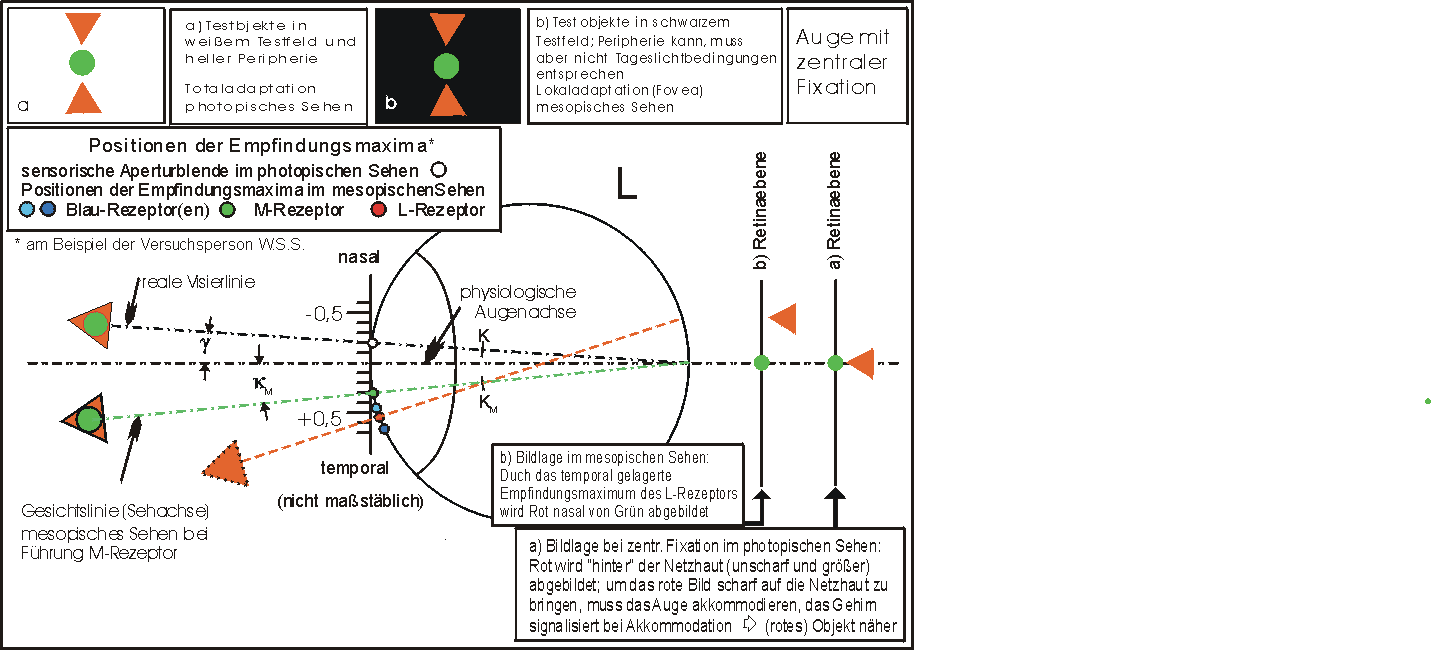
Abbildung 8:
Horizontaler Schnitt durch das linke
Auge des Probanden W.S.S.;
Positionen der
Empfindungsmaxima an der Hornhautvorderfläche; schematische
Darstellung
der Bildentstehung bei zentraler Fixation im photopischen Sehen
und im mesopischen Sehen.
Darstellung von Winkel Gamma und Winkel KappaM [riedl]
Zentrale Fixation
Im
monokularen photopischen Sehen werden sowohl das rote als auch
das grüne
Testobjekt zentral abgebildet. Fixiert das Auge den grünen
Testteil, entsteht
das rote Bild bedingt durch den Farbenlängsfehler „hinter“ der
Netzhaut, wird
unscharf und größer wahrgenommen. Durch Akkommodation wird
das rote Bild auf
die Netzhaut geholt. Es mag oder wird sein, dass durch die
Akkommodation die
Wahrnehmung „Näher“ signalisiert wird, auch kann die
Größe des Bildes einen
solchen Eindruck hervorrufen.
Im
Binokularsehen soll nach Angabe mancher Autoren im geführten Auge
das Bild mit
der längeren Schnittweite – durch Konvergenz bedingt – temporal
von der
Foveolamitte abgebildet werden. Temporal querdisparate Abbildung
führt zur
Wahrnehmung „Näher“. Dieser mögliche Vorgang sei der Ordnung
wegen erwähnt. Er
ist zwar gedanklich nachvollziehbar, konnte aber bei den Versuchen des
Verfassers (ebenso wenig wie der durch Akkommodation und
Größe verursachte
Effekt) nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden
(Abb.8,
unterer Kasten zu „a“).
Fixationsdisparation
Eindeutig werden
die Angaben der Versuchspersonen,
wenn Eso-Fixationsdisparation ins Spiel kommt. Eso-FD führt im
abweichenden
Auge zu nasaler Verlagerung der Farbzerstreuung. Bei Fixation von Rot
(Grün)
liegt im führenden Auge das zugehörige Bild (zusammen mit dem
grünen) in der
Foveolamitte. Im abweichenden Auge liegen beide Bildorte nasal von der
„Mitte“,
jedoch Rot weniger dezentriert als Grün. Binokular liegt somit
temporale
Bildlage von Rot vor. Es wird die Wahrnehmung Rot näher
vermittelt. Während die
Experimente mit Winkelrechtsichtigkeit, also mit bizentraler Fixation,
noch
Unsicherheiten zeigten, war die geschilderte Farbenstereopsis bei
Vorliegen
einer Eso-Fixationsdisparation ganz klar nachweisbar (Abb.9).
Schobers „Wettstreit“ mit der
Aussage, weißer Hintergrund reflektiere alle Farben, schwarzer
jedoch keine
[6], ist nun so zu deuten, dass nur die Empfindung eines polychromen
Spektrums
die Foveola in die Lage versetzt, Öffnungsstrahlen des
Strahlenkegels nach
bestimmten Kriterien des Farbenfehlers zu selektieren. Schwarzer und
monochromer Hintergrund verhindern jedoch die Empfindung von
Dispersion. Die
beschriebene Selektion nach Kriterien der spektralen Zerlegung
polychromen
Lichtes kann also nicht erfolgen. Für das Auge tritt dieselbe
Situation wie
beim Übergang zum Dämmerungssehen (mesopisch) ein: Die
Hohlleiterfunktion der
Farbrezeptoren wird aktiviert.
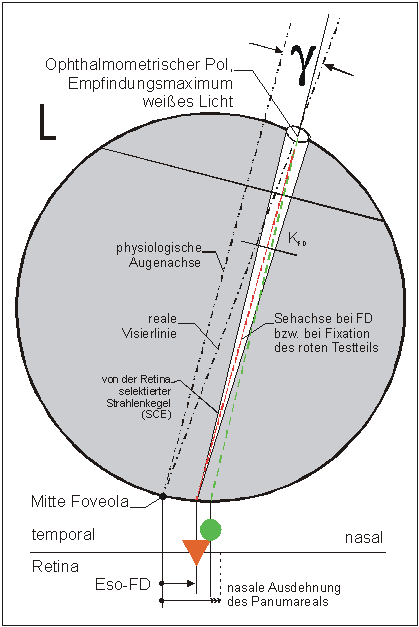
Abbildung 9:
Farbenstereopsis im photopischen Sehen
bei Esofixationsdisparation (schematisch); abweichendes linkes Auge
beim
Anblicken des roten Testteils. Eso-FD verlagert im abweichenden Auge
das Bild
nasal der Foveolamitte; optisches Zentrum der Hornhautvorderfläche
ist der
ophthalmometrische Pol (die sensorische Aperturblende für
weißes Licht ergibt
sich aus dem von der Retina selektierten Strahlenkegel); polychromes
Licht wird
in seine monochromen Bestandteile zerlegt (Dispersion), Rot wird
weniger
abgelenkt als Grün und liegt somit temporal,► Wahrnehmung: Rot
näher.
Es ergibt sich
somit ein ganz neuer Aspekt für die
Ursache von Farbenstereopsis. Im photopischen Sehen ist zweifellos der
Farbenquerfehler des Auges für die Farbenstereopsis
verantwortlich. Verstärkt
werden kann die Wahrnehmung Rot vor Grün (Blau) durch
Eso-Fixationsdisparation.
Die Umkehrung der Tiefenwahrnehmung vor schwarzem Hintergrund
hat jedoch
mit dem Farbenfehler nichts zu tun. Sie ist im mesopischen Sehen eine
Folge der
Hohlleiterfunktion der Zapfen. Unterschiedliche Orientierung der
Photorezeptoren hat unterschiedlich gelagerte Empfindungsmaxima und
unterschiedliche Richtungswahrnehmung für Farben des
zugehörigen
Absorptionsbereichs zur Folge.
Am Beispiel der
Versuchsperson W.S.S. (Stiles) wird
dargestellt, dass bei Empfindung von chromatischer Aberration
(photopisches
Sehen mit weißem Licht) der ophthalmometrische Pol der Hornhaut
als optisches
Zentrum wirkt. Weißes Licht, das geneigt zur realen Visierlinie
auf die
Hornhautvorderfläche trifft, wird zerstreut. Liegen Umstände
vor, die im
geführten Auge zu einer nasal von der Mitte der Foveola
entstehenden Abbildung
führen (Eso-FD), so wird die Dispersion verlagert. Da Grün
stärker abgelenkt
wird als Rot, entsteht das grüne Bild nasal von Rot. Somit liegt
im
Binokularsehen Rot temporal von Grün und führt zur
Wahrnehmung Rot näher.
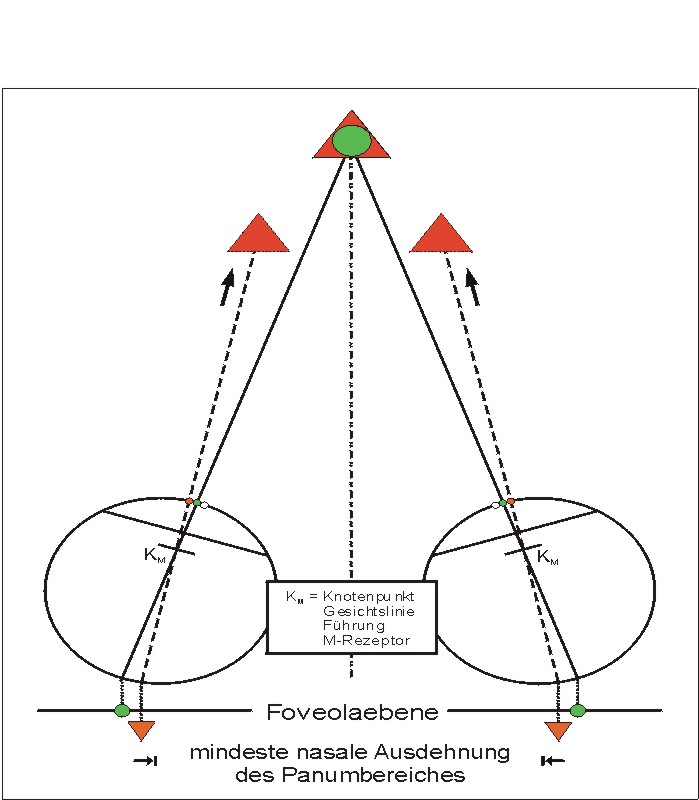
Abbildung
10: Farbenstereopsis im mesopischen Sehen bei Aktivierung der
Hohlleiterfunktion von Photorezeptoren; horizontal versetzte Positionen
der
Empfindungsmaxima der Photorezeptoren führen zu querdisparater
Lage der im
jeweiligen Absorptionsbereich erzeugten Bilder; das Beispiel W.S.S.
zeigt, dass
bei Fixation des grünen Testteils Rot binokular nasal von
Grün abgebildet wird
► Wahrnehmung Rot weiter. Mindestausdehnung des Panumbereiches zur
Wahrnehmung von Farbenstereopsis.
Am Beispiel W.S.S.
wird auch deutlich, dass er
vermutlich zu den Personen gehört haben dürfte, die bei
Aktivierung der
Hohlleiterfunktion, also vor schwarzem Hintergrund, eine deutlich
ausgeprägtere
Farbenstereopsis gehabt haben werden als vor weißem Hintergrund.
Da Donders
sein Schlüsselerlebnis an einer Tapete mit einem Netz gelber
Streifen auf
blau-schwarzem Untergrund hatte, ist davon auszugehen, dass nicht die
von
seinem Assistenten Einthoven gemutmaßte chromatische
Aberration bei
„Abweichung der optischen Achse“ von der Netzhautgrube Ursache seiner
Farbenstereopsis war, sondern – weil dieser Sehvorgang sich im
mesopischen
Sehen abspielte – wahrscheinlich ein nasal vom Empfindungsmaximum des
Blaurezeptors (S) gelagertes Empfindungsmaximum des L-Rezeptors vorlag.
Der
Autor muss sich damit von seiner vor zehn Jahren geäußerten
Vermutung
distanzieren, Donders müsse eine hochgradige
Eso-Fixationsdisparation gehabt
haben. Aus der vorliegenden Betrachtung (SCE) ergibt sich nämlich
eine ganz
andere Interpretation. Und im Nachhinein ist auch die Erklärung
„chromatische
Aberration bei Fehlzentrierung des Auges“ für die von Einthoven
untersuchten Fälle mit einem dicken Fragezeichen zu versehen, weil
Donders’
Erlebnis eindeutig dem mesopischen Sehen zuzuordnen ist, bei dem ganz
sicher
die Hohlleiterfunktion aktiviert war.
Einthovens Probanden
Ebenso sicher, wie Donders’
Beobachtung dem
mesopischen Sehen zuzuordnen ist, ist auch anzunehmen, dass Einthoven
seine Experimente vor schwarzem Hintergrund durchführte. Die
Verteilung von je
50 Prozent seiner dreißig Versuchspersonen, die Rot vor Blau
(Grün) bzw. Blau
(Grün) vor Rot wahrnahmen, kann folglich weder dem Farbenfehler
noch dem
Gammawinkel zugerechnet werden, sondern ist allein einer
unterschiedlichen
Ausrichtung (Orientierung) der Farbrezeptoren zuzuschreiben. Dass dem
so ist,
konnte allerdings Einthoven noch nicht ahnen, da Erkenntnisse
des Stiles-Crawford-Effektes,
mit deren Hilfe erstmalig die Zuordnung zum mesopischen Sehen –
statt
des vermeintlichen photopischen Sehens – und die Beziehung zu den
Empfindungsmaxima monochromen Lichtes auf funktionsbezogener Basis ermöglicht
worden wäre, erst ein halbes Jahrhundert später datieren.
Schlussfolgerung
Die vorliegenden
Überlegungen lassen die
Farbenstereopsis nicht nur in einem anderen Licht erscheinen, weil sie
den
Zusammenhang mit Gammawinkel und die angeblich mögliche
wechselseitige
Versetzung der Netzhautgrube gegenüber dem hinteren Augenpol der
Gattung
„ungewisse Hilfskonstruktionen“ zuordnen. Die Darlegungen
begründen auch, warum
Farbenstereopsis von verschiedenen Versuchspersonen nicht nur
verschieden,
sondern beim Wechsel der retinalen Verarbeitung vom photopischen zum
mesopischen
Sehen von ein und
derselben Versuchsperson auch
gegensätzlich wahrgenommen werden kann.
Farbenstereopsis
weist somit die Existenz einer sensorischen
Aperturblende für weißes Licht einerseits und die
Wirksamkeit verschiedener
Aperturblenden für einzelne Rezeptortypen andererseits nach. Die
laterale
Position der Aperturblende(n) drückt sich in der jeweiligen Lage
der
Empfindungsmaxima des Stiles-Crawford-Effektes aus.

Abbildung 11:
Mögliche Position der
SC-Empfindungsmaxima, die im mesopischen Sehen die Tiefenwahrnehmung
Rot vor
Grün (Blau) erzeugen würde; diese oder ähnliche
Konstellation kann bei 50
Prozent der Versuchspersonen Einthovens vorgelegen haben, die (auf
schwarzem
Grund?) Rot vor Blau (Grün) wahrnahmen; als Bündeldurchmesser
in Ebene der
Hornhautvorderfläche wird 1,3mm angenommen.
Mit dem Nachweis der
optischen Wirksamkeit der Empfindungsmaxima von Photorezeptoren als
alternative
Ursache von Farbenstereopsis ist belegt, dass dem
Stiles-Crawford-Effekt in
Bezug auf Position – und Ausdehnung – zentral abbildender
Strahlenbündel eine
gewichtige optometrische Bedeutung gleichermaßen für das
photopische
(Schwelle!) und das mesopische Sehen zukommt!
Literaturverzeichnis
[2]
Dr.
J. Reiner: Farbenstereoskopie, SOZ 7/55, S. 189 bis 192
[3] Duke-Elder:
System of Ophthalmology, Ophthalmic Optics and Refraction, Henry
Kimpton
London, 1970, S. 170
[4] Dr.
Jutta Eckenfels:
Die geometrische und die wahrgenommene Bildgröße im
visuellen Prozess, Teil IX,
DOZ 3/2001, S. 28
[5] Helmut
Goersch:
Wörterbuch der Optometrie, Verlag Bode Pforzheim 2001
[6] Schober:
Das Sehen,
Band 2, Fachbuchverlag Leipzig, 1958, S. 373
[7] Hans
W. Riedl: Pupille
– Aperturblende des Auges?, Der Augenoptiker 5/97, S. 119 bis 123
[8] W.
S. Stiles: The luminous efficiency of monochromatic rays entering the
eye pupil
at different points and a new colour effect, Royal Society of London,
123-B
(1937), S. 90 bis 118
Anschrift des Autors:
Hans W. Riedl
Am Steinberg 28
91217 Hersbruck
eMail: hansw.riedl@t-online.de
